E-Mobilität gegen Blackouts
Entlastung statt Belastung
21. Mai 2025 agvs-upsa.ch – Eine Studie von energie-cluster.ch zeigt, dass Elektromobilität und Ladeinfrastruktur helfen können, das Stromnetz zu stabilisieren. Gleichzeitig eröffnet dies Chancen gerade auch für Garagen.

Eine klug geplante Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge kann das Stromnetz entlasten und stabilisieren. Foto: iStock
pd/ama. Nicht erst seit dem Blackout in Teilen Spaniens und Portugals Ende April ist das Bewusstsein um die Problematik der Energieversorgung noch stärker gestiegen. Es war ein Schock, wie das Leben auf der iberischen Halbinsel lahmgelegt wurde. Und schnell war klar: Ähnliches kann anderswo passieren, kein Land ist davor gefeit. Auch nicht die Schweiz, selbst wenn wir über eines der stabilsten Stromnetze Europas verfügen.
Die Energiewende stellt unser Stromsystem vor grosse Herausforderungen, bietet aber auch grosse Chancen. Die neue Studie von energie-cluster.ch mit dem Titel «Auslegeordnung system- und netzdienliche Ladeinfrastrukturen» zeigt auf, wie eine kluge Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge das Stromnetz nicht belastet, sondern entlasten und stabilisieren kann, wenn sie richtig geplant und umgesetzt wird.
Effizienz trifft Rentabilität
Die Kombination von Ladeinfrastruktur mit Eigenstromerzeugung und -speicherung ermöglicht eine effiziente Energieverwendung sowie lokal eine höhere Rentabilität. Überschüssiger Strom kann lokal genutzt oder dem Netz zur Verfügung gestellt werden. So wird das Stromnetz stabilisiert, die Stromverfügbarkeit verbessert, ein unnötiger kostspieliger Netzausbau vermieden – und werden ergo Steuergelder eingespart. System- und netzdienliche Ladeinfrastrukturen haben grosses Potenzial, insbesondere im Zusammenspiel Fahrzeug und Netz, heisst es in der Studie. Ebenso bestehen bei der Nutzung der Flexibilität der Batterien Möglichkeiten für ganz neue Geschäftsmodelle.
E-Autos als Teil der Netze
Fahrzeugtraktionsbatterien besitzen heute eine erstaunlich grosse Speicherkapazität, die von Fahrzeugnutzenden im Alltag oftmals nicht vollständig benötigt wird. Durch gezielte Auf- und Entladung können die Kosten für Ausgleichsenergie und somit die Energiekosten reduziert werden. Trotzdem ist natürlich sichergestellt, dass das Auto bei Bedarf am Morgen geladen ist. Für den system- und netzdienlichen Betrieb müssen die Fahrzeuge aber verschiedene Grundvoraussetzungen erfüllen; beispielsweise eine variable Ladeleistung zulassen und in der Lage sein, die Ladeleistung zu steuern.
Schlüsselfunktion für Garagen
Auch die Hersteller der Fahrzeuge werden mit Anforderungen konfrontiert, darunter längeren Betriebszeiten der Batterien oder der Notwendigkeit, dass mehr Fahrzeuge einen bidirektionalen Betrieb zulassen. Der Fahrzeuglieferant – also auch Garagistinnen und Garagisten – hat eine Schlüsselfunktion inne, da er für Fahrzeugkaufende den Erstkontakt darstellt. So bietet sich die Möglichkeit, im Rahmen der Beratung die Kundschaft zu pflegen, die Beziehung zu stärken und neben dem eigentlichen Geschäft mit dem Fahrzeug (Verkauf und Serviceleistungen) Zusatzleistungen mitzuliefern.
Energiewende, Elektromobilität und Ladeinfrastruktur werden uns auch in Zukunft beschäftigen und brauchen Zeit. Für eine flächendeckende Umsetzung sind klare gesetzliche Rahmenbedingungen und wirtschaftliche Anreize erforderlich. Es braucht, wie auch die Studie von energie-cluster.ch zeigt, die Zusammenarbeit aller Akteure, von der Politik über Energieversorger bis hin zu Gemeinden und der Zivilgesellschaft. Also auch der Autofahrerinnen und Autofahrer sowie der Garagistinnen und Garagisten.
Hier finden Sie die vollständige Studie (als PDF).

Eine klug geplante Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge kann das Stromnetz entlasten und stabilisieren. Foto: iStock
pd/ama. Nicht erst seit dem Blackout in Teilen Spaniens und Portugals Ende April ist das Bewusstsein um die Problematik der Energieversorgung noch stärker gestiegen. Es war ein Schock, wie das Leben auf der iberischen Halbinsel lahmgelegt wurde. Und schnell war klar: Ähnliches kann anderswo passieren, kein Land ist davor gefeit. Auch nicht die Schweiz, selbst wenn wir über eines der stabilsten Stromnetze Europas verfügen.
Die Energiewende stellt unser Stromsystem vor grosse Herausforderungen, bietet aber auch grosse Chancen. Die neue Studie von energie-cluster.ch mit dem Titel «Auslegeordnung system- und netzdienliche Ladeinfrastrukturen» zeigt auf, wie eine kluge Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge das Stromnetz nicht belastet, sondern entlasten und stabilisieren kann, wenn sie richtig geplant und umgesetzt wird.
Effizienz trifft Rentabilität
Die Kombination von Ladeinfrastruktur mit Eigenstromerzeugung und -speicherung ermöglicht eine effiziente Energieverwendung sowie lokal eine höhere Rentabilität. Überschüssiger Strom kann lokal genutzt oder dem Netz zur Verfügung gestellt werden. So wird das Stromnetz stabilisiert, die Stromverfügbarkeit verbessert, ein unnötiger kostspieliger Netzausbau vermieden – und werden ergo Steuergelder eingespart. System- und netzdienliche Ladeinfrastrukturen haben grosses Potenzial, insbesondere im Zusammenspiel Fahrzeug und Netz, heisst es in der Studie. Ebenso bestehen bei der Nutzung der Flexibilität der Batterien Möglichkeiten für ganz neue Geschäftsmodelle.
E-Autos als Teil der Netze
Fahrzeugtraktionsbatterien besitzen heute eine erstaunlich grosse Speicherkapazität, die von Fahrzeugnutzenden im Alltag oftmals nicht vollständig benötigt wird. Durch gezielte Auf- und Entladung können die Kosten für Ausgleichsenergie und somit die Energiekosten reduziert werden. Trotzdem ist natürlich sichergestellt, dass das Auto bei Bedarf am Morgen geladen ist. Für den system- und netzdienlichen Betrieb müssen die Fahrzeuge aber verschiedene Grundvoraussetzungen erfüllen; beispielsweise eine variable Ladeleistung zulassen und in der Lage sein, die Ladeleistung zu steuern.
Schlüsselfunktion für Garagen
Auch die Hersteller der Fahrzeuge werden mit Anforderungen konfrontiert, darunter längeren Betriebszeiten der Batterien oder der Notwendigkeit, dass mehr Fahrzeuge einen bidirektionalen Betrieb zulassen. Der Fahrzeuglieferant – also auch Garagistinnen und Garagisten – hat eine Schlüsselfunktion inne, da er für Fahrzeugkaufende den Erstkontakt darstellt. So bietet sich die Möglichkeit, im Rahmen der Beratung die Kundschaft zu pflegen, die Beziehung zu stärken und neben dem eigentlichen Geschäft mit dem Fahrzeug (Verkauf und Serviceleistungen) Zusatzleistungen mitzuliefern.
Energiewende, Elektromobilität und Ladeinfrastruktur werden uns auch in Zukunft beschäftigen und brauchen Zeit. Für eine flächendeckende Umsetzung sind klare gesetzliche Rahmenbedingungen und wirtschaftliche Anreize erforderlich. Es braucht, wie auch die Studie von energie-cluster.ch zeigt, die Zusammenarbeit aller Akteure, von der Politik über Energieversorger bis hin zu Gemeinden und der Zivilgesellschaft. Also auch der Autofahrerinnen und Autofahrer sowie der Garagistinnen und Garagisten.
Hier finden Sie die vollständige Studie (als PDF).
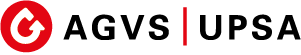

Kommentar hinzufügen
Kommentare